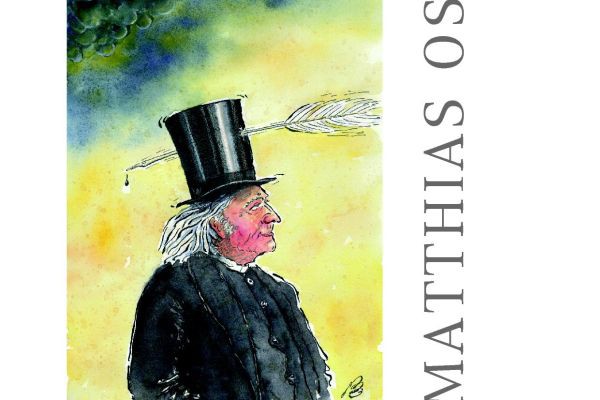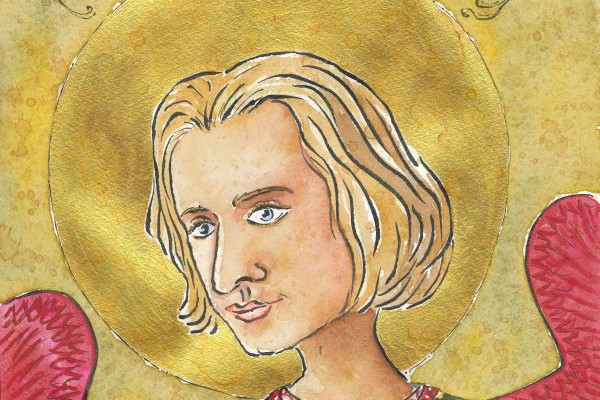Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Matthias!
Es musste ja einmal so kommen, es lag förmlich in der Luft und war unausweichlich: Irgendwann würde sich Matthias Ose nach sehr viel Wagnerischem und manch anderem auch Franz Liszt intensiv zuwenden, es war nur eine Frage der Zeit. Bildideen, Einfälle und verschiedene Gedankenblitze mögen sich bereits seit längerem angesammelt haben, nun verdichteten sie sich zu einem ausstellungsreifen Zyklus, dessen inneren Zusammenhang sowohl die Biografie als auch die Wirkung der Ausnahmepersönlichkeit Liszt stiften. Das offizielle Gedenkjahr und die für Bayreuths Feierlichkeiten ausgegebene Losung „Lust auf Liszt“ dürften stimulierend-begünstigend am geglückten Projekt mitgewirkt haben. Und selbstverständlich die Möglichkeit, die Zeichnungen erneut in den Räumen der Commerzbank präsentieren zu können, deren kunstsinnigem und kunstförderndem Direktor Michael Lützelberger gar nicht genug für sein Engagement zu danken ist.
Der Ausstellungstitel klingt womöglich etwas irreführend: „Liszt am Spieß“ – weckt er doch im ersten Moment Vorstellungen, als ob dabei der arme Liszt sensationsheischend und lustvoll am Bratspieß der Satire geschmort würde oder überm Feuer spöttischer Parodie rösten müsste. Wer Matthias Oses besondere Art und seinen Stil aber auch nur ein wenig kennt, weiß, dass es so brutal und direkt bei ihm niemals hergeht. Sein Werkzeug ist eben nicht das Tranchiermesser, sondern die behutsam forschende, ja verspielte, doch gleichwohl stets punktgenau treffende Zeichenfeder. Allein mit ihr ‚spießt‘ er seinen Gegenstand auf, verwandelt er biografische Fakten, überlieferten Alltag, Zitate, scheinbar Randständiges, mitunter Prekäres, aber auch Großes und Großartiges in seine unverwechselbaren Bilder, die fast immer der Ausdruck einer schlaglichtartigen Momentaufnahme sind. Sie, die Bilder, stellen häufig die dargestellten Dinge oder Situationen von den Füßen auf den Kopf oder kehren ihren vordergründigen, bisweilen sogar banalen Sinn in einen hintergründigen, ja meistens untergründigen um. Vorausgesetzt, er ist zu gedanklicher und emotionaler Mitarbeit bereit und fähig, fällt dem Betrachter damit die durchaus fröhliche Aufgabe zu, eine neue ‚Ordnung‘ zwischen der Realität und dem Gezeichneten herzustellen, alles neu zusammenzusetzen und dadurch neue, vielleicht unbekannte Sinnzusammenhänge zu entdecken. Man darf das Ergebnis dieser ‚Arbeit‘ wohl als Vergnügen bezeichnen und ihre Mittel bzw. unerlässlichen Bedingungen als Humor. Schlecht dran ist nur der derjenige – aber davon sehe ich hier keinen –, welcher dafür keinen Sinn besitzt.
Wie alles aus dem Mittelmaß Herausragende, wie alles nicht der Konvention und zeitbedingt geltenden Norm Entsprechende, bemächtigte sich die Karikatur schon zu Lebzeiten und früh der Persönlichkeit Franz Liszts: Seine rätselhaft-übermenschlichen, ja dämonisch empfundenen Fähigkeiten als Pianist, als „Klavierspieler des Teufels“, sein exzeptionell gelebtes Virtuosentum und sein provozierendes Privatleben, das Menschlich-Allzumenschliche, gaben genugsam Stoff, um ihn angreifbar zu machen und ihn in vielfältiger Weise zu karikieren, mal stichelnd, mal gehässig, mal bewundernd. In den späteren Jahrzehnten waren es Liszts energischer und aufopferungsvoller Einsatz für Richard Wagner und natürlich sein eigenes kompositorisches Schaffen, dass die Karikaturisten herausforderte.
Es kann nicht weiter erstaunen, dass sich auch Heinrich Heine in der ihm eigenen Art mit Franz Liszt auseinandersetzte. In Paris standen sich beide zwar persönlich nahe, aber Heine blieb trotzdem der Skeptiker und unnachsichtige Kritiker, dem der so ganz anders veranlagte Liszt letztlich suspekt war. Nachdem im Herbst 1849 der Freiheitsaufstand in Ungarn blutig niedergeschlagen worden war, dichtete Heine auf Liszt, der 1840 den Ehrensäbel des ungarischen Adels erhalten hatte:
„Es fiel der Feiheit letzte Schanz‘,
Und Ungarn blutet sich zu Tode –
Doch unversehrt blieb Ritter Franz,
Sein Säbel auch – er liegt in der Kommode.“
Und in einem Spottgedicht auf den „Jung-Katerverein für Poesie-Musik“, womit Heine die „Neudeutsche Schule“ mit Wagner und Liszt an der Spitze treffen wollte, stehen die Verse:
„Die sinnebetörte Wöchnerin
Hat ganz ihr Gedächtnis verloren;
Sie weiß nicht mehr, wer der Vater ist
Des Kindes, das sie geboren.‚War es der Peter? War es der Paul?
Sag, Liese, wer ist der Vater?‘
Die Liese lächelt verklärt und spricht:
‚Oh, Liszt! du himmlischer Kater!‘“
Seine religiöse Wende vom Saulus zum Paulus, die befremdend anmutende Wandlung vom weltgewandten Liebling der Salons zum frommen Abbé, erzeugte ebenso bissige zeichnerische Kommentare wie sein markantes und einprägsames Äußere: Die löwenartige Haarmähne, die große hakenförmige Nase, im Alter die zahlreichen Warzen im Gesicht und das geistliche Gewand, die Soutane, die er dann stets trug.
All das waren Punkte und Flächen der Zeitgestalt Liszts, die die Karikaturisten des 19. Jahrhunderts offensichtlich mit Genuss und boshafter Phantasie aufgriffen. Ob das Liszt verletzte und wie tief, kann ich nicht sagen – dass all dies seinen ungeheuren Ruhm, seine Bekanntheit und seinen schillernden Ruf noch befördern half, steht wohl außer Frage. Die missliche Kehrseite davon war jedoch, dass auf solche Weise eine Unzahl zählebiger Klischees entstanden und in Umlauf kamen, von denen wir uns bis heute noch nicht vollständig befreien konnten. Von ihnen gleichsam übermalt ist nach wie vor zu einem Großteil Liszts vielfältige, unausgelotete und verkannte Künstlerschaft.
Matthias Ose nun hat einen anderen Zugang zu Liszt, gefiltert und gemäßigt nicht zuletzt durch den enormen historischen Abstand. Er ist frei von Polemik und sieht sich in die glückliche Lage versetzt, mit dem überlieferten Material unbelastet spielen zu können. Und dies vollbringt er in der ihm eigenen Weise: souverän, mit einer schwebenden Leichtigkeit und der gewohnten, seinen Stil kennzeichnenden doppelbödigen, manchmal flirtenden, manchmal kauzigen Ironie. Sie ist nicht gefährlich oder bissig, eher sanftkantig und auf eine fabelhafte Art verdreht witzig. Mehr und mehr erkenne ich in seinem Schaffen eine innige Geistesverwandtschaft zu Figuren wie Karl Valentin, Gerhard Polt und Helge Schneider – skurril, durchtrieben, im wörtlichen Sine un-verschämt, aber gleichzeitig menschlich und liebevoll. Da ist keinerlei Heimtücke oder Häme, er lockt uns allenfalls ab und zu in einen kleinen Hinterhalt der Einsicht von Torheit im Pathos und Groteske im Alltag. Dafür sei Matthias Ose von Herzen gedankt!
Und im Übrigen gilt, trotz aller freundlichen Worte: „Das Werk lobt den Meister.“ (Jesus Sirach 9,24)
Peter Emmerich
Bayreuth, 27.06.2011